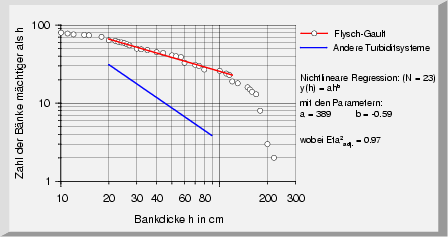Nächste Seite: Methodik
Aufwärts: Geologischer Rahmen
Vorherige Seite: Zum Flyschbegriff
Inhalt
Index
Zur Paläogeographie
Aus den weiter oben genannten Gründen werden in den meisten
Veröffentlichungen die Sedimente der Rhenodanubischen Flysch-Zone als
eine Subduktionssenken-Füllung, die einer nach Norden wandernden
alpinen Deformationsfront vorgelagert war, interpretiert
(z.B. Faupl & Wagreich, 1992; Wildi, 1990; Egger, 1992; Ziegler, 1988a,b). Ich halte
diese Interpretation aus den folgenden Gründen jedoch für
problematisch:
- Die Frage nach dem Liefergebiet der Flyschsedimente ist bis
heute nur unbefriedigend gelöst. So können die Sedimente des
siliziklastischen Flysch-Gault nicht mit Sicherheit auf bekannte
Liefergebiete im alpinen Raum bezogen werden.
- Von den starken orogenen Bewegungen der Gosau Bildungen in den
Nördlichen Kalkalpen, die durch Vertikalbewegungen in der Oberkreide
mehr als 1000 m ü.NN. gehoben wurden (mündl. Mittlg. STEIGER,
1995), fehlt jede Spur in den Flyschsedimenten. Ebenso fehlen
Anzeichen der aus dem Helvetikum und Ultrahelvetikum bekannt
gewordenen Ophiolithvorkommen (Dietrich & Franz, 1976).
- Dickinson & Suczek (1979) gelang es einen Zusammenhang zwischen
Sandsteinpetrographie und Tektonik der Sandsteinliefergebiete
herzustellen. Die von ihnen benutzten Parameter sind der Quarz- und
Feldspatgehalt sowie der Gehalt an Gesteinsbruchstücken. Untersucht
man die petrographische Zusammensetzung der Flysch-Gault-Sandsteine
nach diesem Schema, läßt sich kein Zusammenhang mit einem einer
Subduktionssenke assoziierten Inselbogensystem erkennen (s.
Abb.1.7).
Abbildung 1.7:
Modalzusammensetzung (Schema nach Dickinson, 1985) der
Flysch-Gault-Sandsteine. Diese fallen eindeutig in den
Bereich der ,,Recycled Orogenic Sediments`` und nicht in den
Inselbogenbereich. Als Sedimentquelle kämen damit aufgearbeitete
Sedimente eines Faltengürtels (,,fold belt``), orogener
Hochgebiete oder einer Nahtzone
(,,suture belt``) in Frage (op. cit.). Hiervon erscheint die
letzte Möglichkeit als die wahrscheinlichste (Winkler, 1988).
Flysch-Gault-Daten ( 200 Proben) aus
Hesse (1973,1974), Reiselsberger Sandstein Werte aus
v. Rad (1972) und die Puerto Rico-Graben-Daten nach
Connolly & Ewing (1967). Die karbonatischen Bestandteile wurden nicht
berücksichtigt.
200 Proben) aus
Hesse (1973,1974), Reiselsberger Sandstein Werte aus
v. Rad (1972) und die Puerto Rico-Graben-Daten nach
Connolly & Ewing (1967). Die karbonatischen Bestandteile wurden nicht
berücksichtigt.
 |
Aufgrund der intensiven Verwitterung in der Unteren Kreide
(Föllmi et al., 1993; Weissert & Lini, 1991) und der Instabilität der Feldspäte
erscheint es sogar wahrscheinlich, daß der Flysch-Gault eigentlich
in das Feld der kontinentalen Sandsteine gehört und nicht in das
Feld der wiederaufgearbeiteten Quarzite. Die petrographische
Zusammensetzung des Reiselsberger Sandsteins hingegen könnte auch
auf kompressive Tektonik hindeuten. Somit könnte es sich beim
Reiselsberger Sandstein um wiederaufgearbeitete Sedimente eines
Faltengürtels (,,fold belt``) oder einer Nahtzone (,,suture
belt``) handeln (Dickinson, 1985).
- Die Sedimente des Rhenodanubischen Flysches sind in mehrfacher
Hinsicht untypisch für Subduktionssenken-Füllungen:
- Viele der bisher bekannt gewordenen Subduktionssenken-Füllungen
zeigen keine Sand-, sondern eine Schlamm-dominierte Füllung
(s. z.B. Winsemann, 1992; Shipley & Moore, 1986; Schlegel et al., 1995; Shipley et al., 1982; Underwood & Karig, 1980).
- Die Sedimentationsraten des Rhenodanubischen Flysches liegen
mit etwa 1 m/Mio.J. bis 25 m/Mio.J. unter den Sedimentationsraten
anderer Subduktionsgräben. Beispielsweise ergeben sich für den
,,Mid-America Trench`` Sedimentationsraten von 5 m/Mio.J. bis
300 m/Mio.J. (von Huene et al., 1980) und für den Alëuten-Graben
Werte von 40 m/Mio.J. bis 3500 m/Mio.J. (Piper et al., 1973). Ähnliche
Größenordnungen berichtet auch Enos (1991).
- Zur Kreidezeit fehlen sedimentäre Zeugnisse eines ehemaligen
Inselbogens. Die wenigen bekannten vulkanischen Ablagerungen im
alpinen Raum deuten dabei mehr auf Dehnungstektonik als auf ein
Inselbogensystem hin (Oberhänsli, 1986,1977,1978) - eine
Sichtweise, die auch durch kinematische Analysen gestützt wird
(Dewey et al., 1989).
- Der vermutete Zusammenhang zwischen orogenen Hebungen und Beginn
der siliziklastischen Sedimentation im Rhenodanubischen Flysch
(Wildi, 1990) erscheint aufgrund des Skalenverhaltens
(,,scaling``) (Mandelbrot, 1983; Rothman et al., 1994) der Flysch-Gault-Sandsteine
zweifelhaft (s. Abb.1.8).
- Paläomagnetische Messungen (Hauck, 1998) deuten
darauf hin, daß der Flysch-Gault südlich der Nördlichen Kalkalpen
abgelagert wurde.
Abbildung 1.8:
Die
Sedimentationsdynamik in Turbiditsystemen gehorcht in der Regel
einem Exponentialgesetz (Skalenverhalten) das den
Zusammenhang zwischen Häufigkeit und Stärke der Turbidite
beschreibt (Mandelbrot, 1983; Rothman et al., 1994). Der Flysch-Gault zeigt hierbei
ein deutlich anderes Skalenverhalten als andere Turbiditsysteme
(in diesem Beispiel die Kingston Peak Formation, Rothman et al., 1994).
Der starke Knick bei 1.5 m ist durch die Amalgamierung der
einzelnen Bänke bedingt.
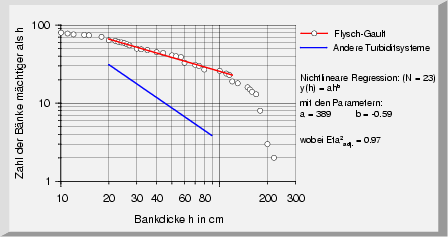 |
Welche Vorstellungen haben nun dazu geführt, daß trotz dieser zum Teil
schon länger bekannten Einwände der Flysch als eine ,,Vortiefe`` der
Ostalpinen Decken interpretiert wurde? Hierzu möchte ich kurz die
gängigen Annahmen, auf die sich die gegenwärtigen Vorstellungen zur
Paläogeographie stützen, vorstellen und kritisch kommentieren:
- Der Rhenodanubische Flysch wird in der Literatur
wiederholt als eine Subduktionssenken-Füllung interpretiert und
hierbei zum Teil sogar als Beleg für eine Subduktionszone gesehen
(z.B. Wildi, 1990; Egger, 1992; Ziegler, 1988a,b). Wie im vorigen
Kapitel kurz skizziert, wurde der Flyschbegriff, der zunächst nur
eine regionale Bedeutung hatte, durch die Verknüpfung mit der
Turbidittheorie (die globale Bedeutung besitzt) zu einer
Tiefsee-Fazies umgedeutet, die damit nicht mehr regional, sondern
genetisch definiert war. Der so seines regionalen Kontextes
beraubte Flyschbegriff wurde mit dem Aufkommen der Plattentektonik
nun seinerseits zu einem Beleg für eine Subduktionszone, die in
den Alpen einer nach Norden wandernden alpinen Deformationsfront
vorgelagert sein sollte - die historisch verkürzte Perspektive
macht aber deutlich, daß dies ein Zirkelschluß ist.
- In der Literatur wird immer wieder angenommen, daß es
sich bei der Rhenodanubischen Flysch-Zone um einen einheitlichen
Bereich handelt (z.B. Schnabel, 1992). Diese Annahme stützt sich
im wesentlichen auf das über weite Strecken einheitliche
Erscheinungsbild einzelner Schichtglieder (z.B. der Zementmergel
oder des Reiselsberger Sandsteins). Die tatsächliche Verfolgung
einzelner Bänke entlang der Beckenachse ist bislang aber nur im
Flysch-Gault zwischen Oberstdorf und Tegernsee geglückt
(Hesse, 1974) (die Weiterführung bis in den Falknis-Gault
konnte jedoch von Hesse, 1973, wahrscheinlich gemacht werden). Schon die
Fortsetzung des Flysch-Gault in das östlich gelegene
Teisenberg-Gebiet ist problematisch (Freimoser, 1972), und
noch weiter östlich, im Salzburger Raum, tritt der
Flysch-Gault schließlich in einer eigenständigen Fazies auf
(Egger, 1992).
Das über weite Strecken einheitliche Erscheinungsbild der
Zementmergel impliziert aber lediglich einen ähnlich
gearteten Ablagerungsraum. Die Schlußfolgerung, daß es sich dabei um
ein einziges Becken gehandelt hat, ist möglich, aber nicht zwingend.
- Pober & Faupl (1988) und Faupl & Wagreich (1992) haben versucht, die
paläogeographische Lage der Rhenodanubischen Flysch-Zone aus dem
Schwermineralspektrum der Sandsteine abzuleiten. Hierbei wird
zwischen Granat-führenden und Chromspinell-führenden
Turbiditen unterschieden. Die Chromspinelle werden als
ophiolithischer Detritus einer weiter südlich gelegenen
Subduktionszone, wie zum Beispiel der Vardar-Sutur oder der den
Nördlichen Kalkalpen vorgelagerten Subduktionszone, interpretiert.
Solche Chromspinell-reichen Turbidite (z.B. der Ybssitzer
Klippenzone) werden daher in das Südpenninikum gestellt. Die
Granatführung hingegen zeigt, daß das Flysch-Hinterland ein stabiler
kontinentaler Block war. Die Granat-haltigen Turbidite der
Rhenodanubischen Flysch-Zone werden daher in das Nordpenninikum
gestellt.
Diese einfache Nord/Süd-Unterscheidung vernachlässigt aber die
möglicherweise in Ost/West-Richtung auftretenden Unterschiede.
Insbesondere scheint eine mittelpenninische
(Oberhauser, 1968,1995) oder gar nordpenninisch/helvetische
Position der Rhenodanubischen Flysch-Zone, nach den
paläomagnetischen Daten von Hauck (1998) nicht mehr haltbar (s. auch
Abschnitt 6.1).






Nächste Seite: Methodik
Aufwärts: Geologischer Rahmen
Vorherige Seite: Zum Flyschbegriff
Inhalt
Index
Wortmann U.G., (1996). Zur Ursache der hemipelagischen....
Last updated by Uli Wortmann 1999-03-09