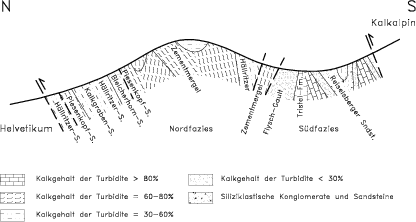 |
,,[...] als ein schwärzlichgraues Schiefer- und Sandstein-Gebirge erscheint, aber durch untergeordnete Kalkstöcke und Kalk-Lager, grosse Massen von Kalk-Brekzie, Lager von schwarzem und lauchgrünem Quarze und Feuersteine u.s.w., einen sehr zusammengesetzten Charakter erhält. Die vorherrschenden, schiefrigen Abänderungen heissen im Lande Flysch, eine Benennung, die wir füglich auf die ganze Formazion ausdehnen können.``Die Rhenodanubische Flysch-Zone, im wesentlichen frei von Makrofossilien, war zeitlich schwer einzuordnen. So dominiert in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Auffassung, der Flysch habe eozänes Alter. Beispielsweise schreibt v. Gümbel (1894):
,,Im auffallenden Contraste zu diesem nur sporadischen Auftauchen der ältesten Tertiärablagerungen [d.h. der Nummulitenschichten] stellen sich jene zunächst jüngeren, vielfach noch dem Eocän zugerechneten Mergel, Sandsteine und Conglomerat-Bildungen, für welche man in der Schweiz die Bezeichnung Flysch zu benützen pflegt.``Zum Ende des Jahrhunderts mehren sich aber die Hinweise, daß der Flysch
Erst in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts begann die systematische Untersuchung des bayerischen Flysches durch E. KRAUS, M. RICHTER und ihre Schüler. Kraus (1927a,b) erkennt die Zweigliederung der Flysch-Decke, konnte sich aber mit dieser Ansicht gegen Richter (1933) nicht durchsetzen. Stattdessen wird davon ausgegangen, daß es sich um zwei miteinander verzahnte Faziesbereiche handelt (z.B. Reichelt, 1960). Die von Kraus geprägten Begriffe ,,Sigiswanger Fazies`` oder ,,Nordfazies`` und ,,Oberstdorfer Fazies`` oder ,,Südfazies`` sind bis heute gebräuchlich geblieben.
Im Gegensatz zum Wienerwald-Flysch, der bereits im letzten Jahrhundert mikropaläontologisch bearbeitet wurde (Karrer, 1869), erfolgte die mikropaläontologische Bearbeitung des bayerischen Anteils der Rhenodanubischen Flysch-Zone erst durch Bettenstaedt (1958) und Pflaumann (1964). Letzterem gelang es aufgrund faunistischer Kriterien, die Kalkgrabenschichten von der Zementmergelserie abzutrennen und somit die abgesehen vom Reiselsberger Sandstein fazielle Trennung der Nord- und Südfazies zu belegen.
Wurden bis dato die Flyschserien aufgrund ihres Fossilinhaltes als flachmarine Bildungen interpretiert (Zeil, 1961), so begann mit der Wiederbelebung der Turbidit-Hypothese (Daly, 1936; Johnson, 1939) durch Kuenen & Migliorini (1950) eine neue Phase der Flyschforschung. Der Flysch wird jetzt Gegenstand einer Reihe von petrographisch/sedimentologisch orientierten Arbeiten (Hesse, 1972; v. Rad, 1964; Hesse, 1964; Freimoser, 1972; v. Rad, 1972). So gelingt es Hesse (1964), die Turbidite des Flysch-Gault über mehr als 100 km entlang der Beckenachse individuell zu verfolgen und
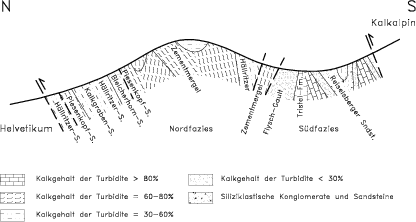 |
Diesem feinstratigraphischen Ansatz folgend gelang es Hesse (1973) den Flysch-Gault mit dem Falknis-Tasna-Gault zu korrelieren und so eine verläßliche Abschätzung der paläogeographischen Position zu ermöglichen (s. Abb.1.3). 1982 publizierte Hesse eine Arbeit, in der er die plattentektonische Stellung der Rhenodanubischen Flysch-Zone untersucht. Er kommt hierbei zu dem Schluß, daß die Rhenodanubische Flysch-Zone Teil eines großen, West-Ost verlaufenden Transformsystems ist, das in Zusammenhang mit einer ,,ruhenden Tiefseesenke`` (,,dormant trench``) steht und sich in den Ostkarpaten in eine aktive Tiefseesenke fortsetzt.
Umwälzende Erkenntnisse sind in den letzten Jahren nicht hinzugekommen. Allerdings sollen zwei Arbeiten nicht unerwähnt bleiben. Zum einen konnte Mattern (1988) zeigen, daß sich die im Allgäu zu beobachtende Überschiebung der Südfazies auf die Nordfazies bis mindestens zum Isartal bei Bad Tölz verfolgen läßt (s. auch Abb.1.5).
Zum anderen argumentiert Egger (1992) im Gegensatz zu Hesse (1973) und Wildi (1990), die die Flysch-Sedimente direkt durch Schüttungen von Süden in das Flyschbecken bezogen (Abb.1.6, links),
 |